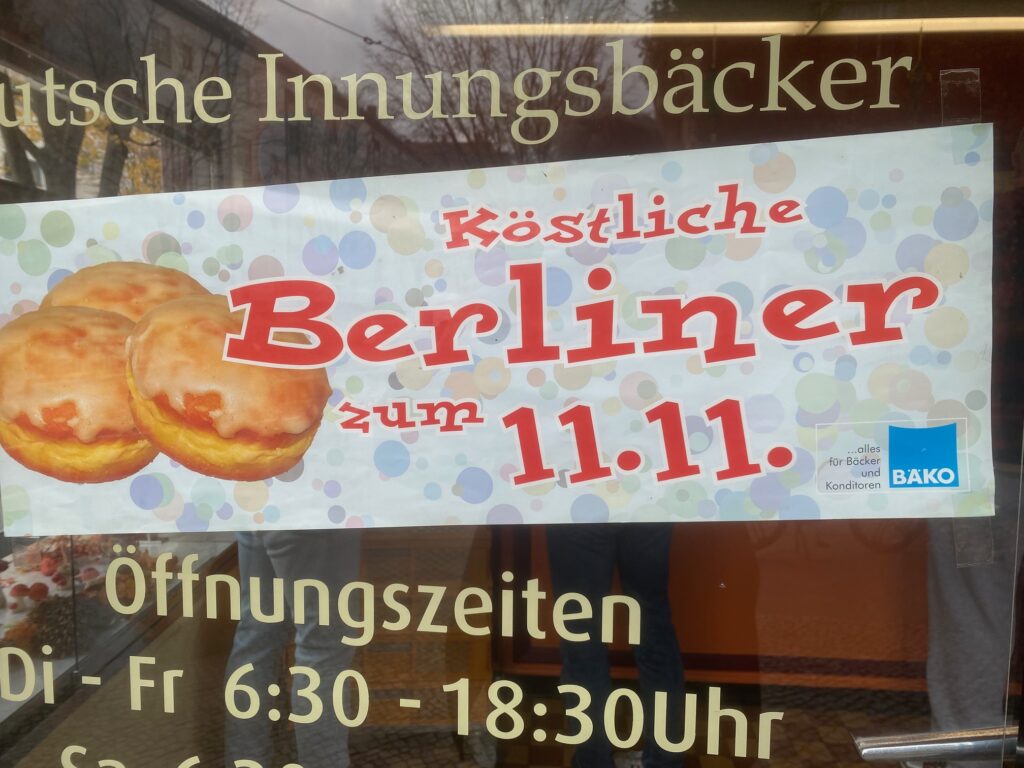Nach dem Tod meines Opas habe ich es oft bedauert, dass ich ihn nicht mehr zu seinem Leben befragt habe. Ich habe meine Eltern gebeten, etwas aus ihren Erinnerungen aufzuschreiben, aber das wird wahrscheinlich nichts. Ich muss sie fragen. Mich kann ich selbst fragen und ich kann auch Dinge aufschreiben. Ich habe beschlossen, das hier zu tun. Kleine Erinnerungen schaffen ein Bild unserer Vergangenheit und ich möchte, dass meine Teil dieses Bildes sind, sonst schreiben andere unsere Geschichte.
Schlagersüßtafel
Es gibt im Netz einen Ossiladen. Mit all dem Zeug, das ich nie mehr sehen wollte. Es gab eine Kosmetikserie, die hieß Action. Hm.
Schlagersüßtafel! Konnte man alles Mögliche mit machen nur nicht essen. Ich hatte mit einem Kumpel (C.) eine Tafel gekauft, weil wir dachten, dass da Bilder von Schlagersänger*innen drin wären.1 Was für ne Enttäuschung. Wir haben dann Passant*innen vom Balkon aus damit beworfen. Irgendwann kam ein Trupp Bauarbeiter. Die hatten offene Farbeimer auf einem Wagen. Die Schokolade flog da rein. Splash. Sie fanden es nicht gut und mussten gerade noch gesehen haben, wo die Schokolade herkam, obwohl wir uns urst schnell geduckt hatten. Sie kamen ins Haus zu uns hoch und klingelten Sturm. Ich dachte mir, die machen ja das ganze Haus verrückt und stellte die Klingel ab. Das war nicht so schlau, denn nun wussten sie ja, dass sie an der richtigen Tür klingelten. Sie klopften stattdessen. Damals waren die Wohnungseingangstüren noch wenig widerstandsfähige Papptüren. Ich hatte Angst. Auch um die Tür. Irgendwann zogen sie ab. Wie immer haben die Nachbarn von unter uns mich an meine Eltern verpetzt.
Die Siedlung
Den Klassenkamerad C. hab ich auch zu Hause besucht. Er wohnte in einem Haus in der Siedlung am Lindenberger Weg und ich im Neubau (Es gab die „alten Neubauten“, die „Neubauten“ und die „neuen Neubauten“. Wir wohnten in den „Neubauten“, die 1976 fertig geworden waren.) Die Familie meines Kumpels hatten da noch Öfen und wir haben Watte verkokelt. Hat Spaß gemacht.
Klassenkeile
Irgendwann später gab es in unserer Klasse eine Situation, in der die Mädchen plötzlich alle ein anderes Mädchen B. scheiße fanden. Sie kam aus einer bildungsfernen Familie. Die Schulklassen in meiner Schule bestanden aus Schüler*innen, deren Eltern in der Akademie der Wissenschaften oder in den Krankenhäusern in Buch arbeiteten. In meiner Klasse sind 8 von 31 Schüler*innen nach der achten Klasse abgegangen. Zwei an die erweiterte Oberschule (Schliemann und Hertz) und sechs Jungen in die Produktion. Zu dieser Zeit begann die normale EOS ab der zehnten Klasse. Die Schliemannschule war eine Spezialschule mit Sprachenausrichtung und die Hertz-Schule eine mit mathematisch-naturwissenschaftlicher Ausrichtung. Die Klasse war jedenfalls wild gemischt. Die Jungs, die die Klasse verließen, waren zum Teil schon einmal sitzen geblieben. Viele waren Frühentwickler, super gut in Sport. Beim 100 Meterlauf konnte ich ihnen nur hinterhergucken.
An besagtem Tag hatte sich die gesamte Klasse gegen das Mädchen zusammengetan. Heute würde das wohl alles unter Mobbing laufen. B. sollte Klassenkeile bekommen. Ich habe versucht zu verstehen, wieso und warum und habe gesagt, sie sollten sie mal in Ruhe lassen. Das führte dazu, dass ich plötzlich im Zentrum des Interesses stand. Keine Ahnung wie. Gruppendynamik halt. Ich weiß noch, dass es in der Turnhalle begann. Ich ging dann einfach los. Nach Hause. Die Klasse kam mir hinterher. Ich bin so ca. zehn Minuten gelaufen, dann wurde ich umstellt und eins der Mädchen nahm meinen Schulranzen. Klassenkeile.
C. sollte mich irgendwie verhauen. Wir standen in der Mitte eines Kreises unserer Klassenkameraden. Ich habe ihn umfasst, seinen Oberkörper nach hinten gebogen und er fiel um. Ich nahm H. meine Mappe aus der Hand und ging nach Hause. Ich habe mich nicht umgedreht. Sie sind mir nicht hinterher gekommen. Ich wüsste gern, was sie gedacht und gesagt haben.
Zu Hause saß ich auf dem Sofa. Ich habe drei Stunden lang gezittert. Es war keine Mutter da und kein Vater. Wie auch, sie haben gearbeitet. Das war gut und normal so. Ich glaube, ich habe auch später nicht mit ihnen darüber gesprochen.
Am nächsten Tag bin ich normal in die Schule gegangen. Kann mich nicht erinnern, dass die Vorgänge vom Vortag thematisiert worden wären. Auch nicht an Angst. Vielleicht verdrängt.
Ich habe gelernt, dass man als Einzelner auch etwas gegen eine Gruppe ausrichten kann. Dass es merkwürdige gruppendynamische Prozesse gibt.
Und eine nicht ganz ernste Bemerkung zum Schluss. Die Nachgeborenen finden ja, wir sollten jetzt mal 1968 im Osten machen und über unsere Gewalterfahrungen reden (Blogpost Gewalterfahrungen und 1968 für den Osten). Das hier sind meine Gewalterfahrungen. Diese sind natürlich nicht gemeint. Es gab alle möglichen Zwänge im Osten, militarisierter Sportunterricht, Wehrunterricht, Verweigerung von Bildungsmöglichkeiten, wenn man nicht mitgespielt hat usw. Nur ist das alles bekannt. Da muss man nichts aufarbeiten.