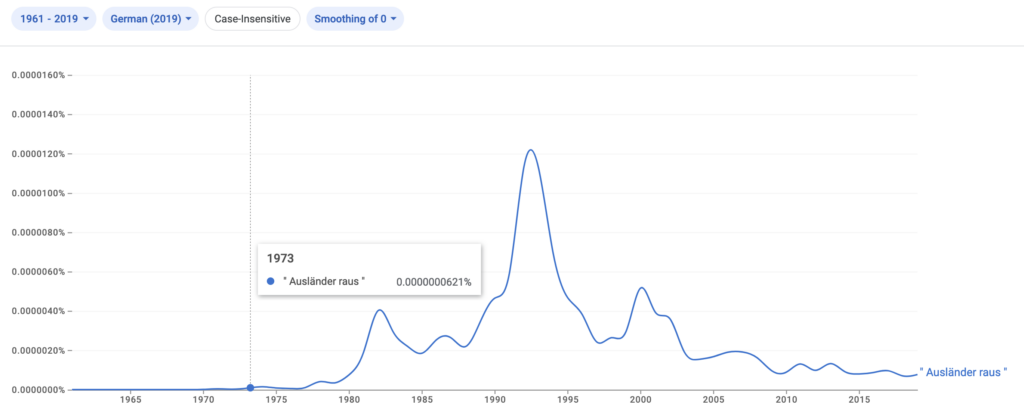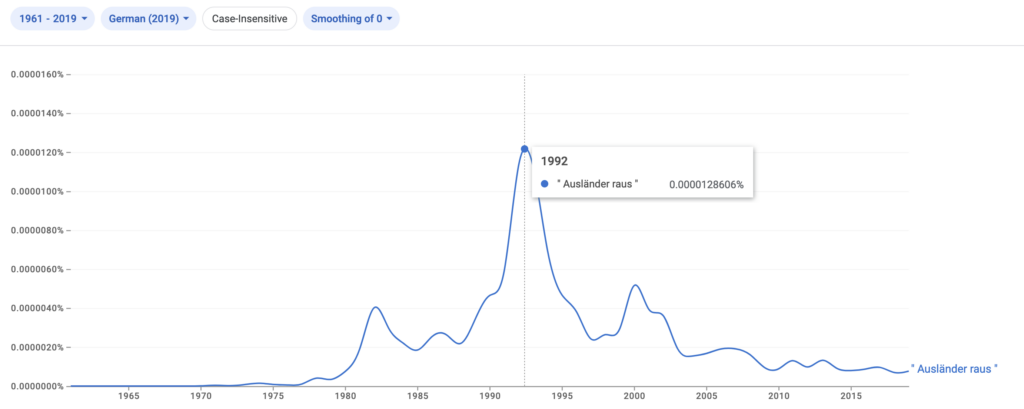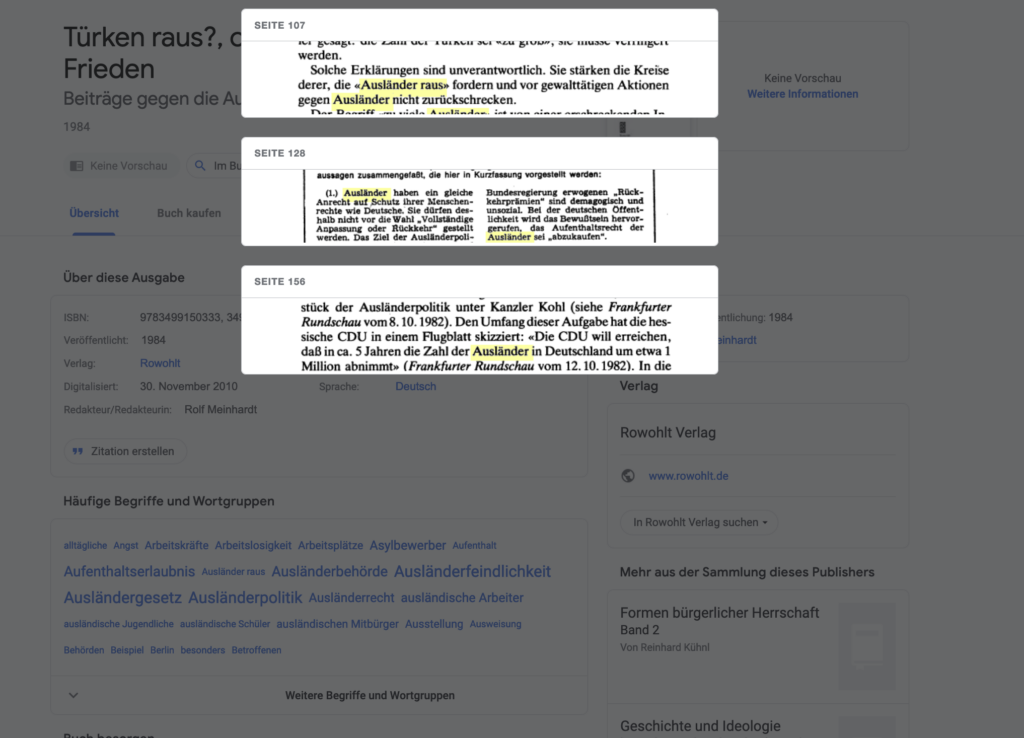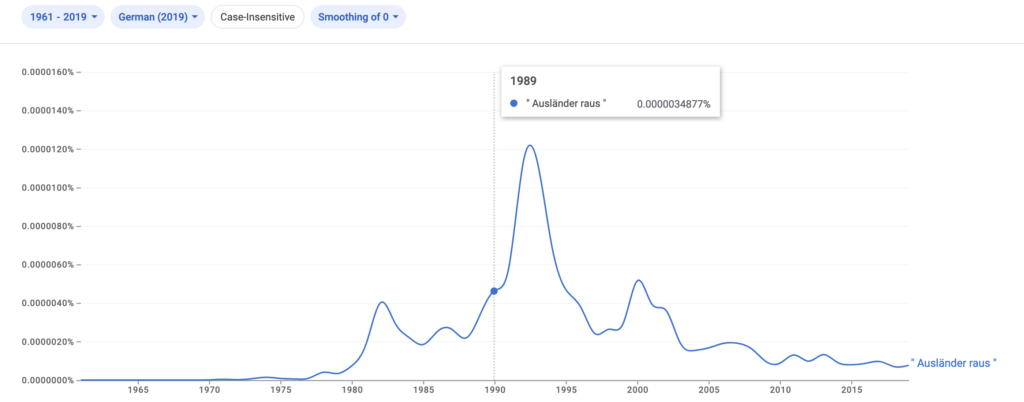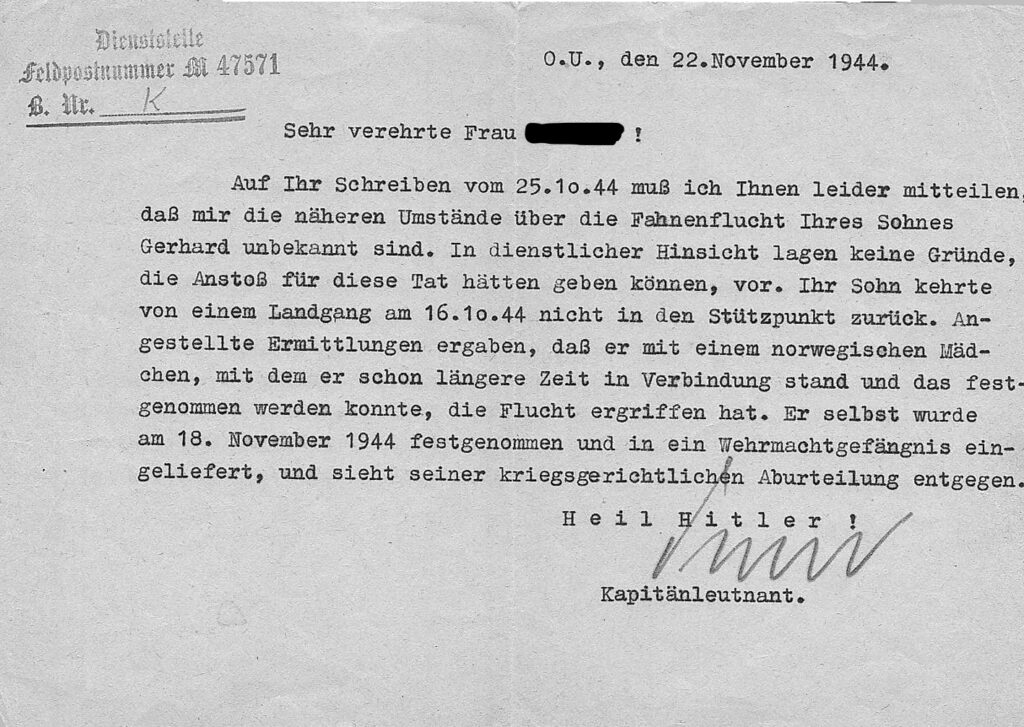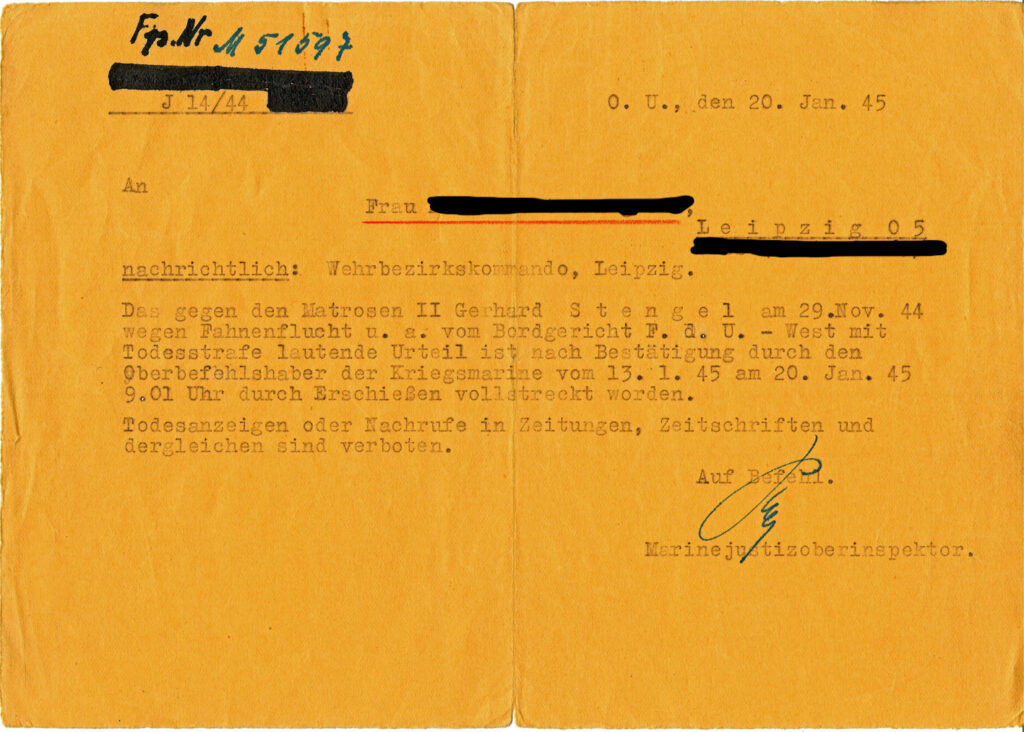Aktualisiert am 27.02.2024
Ich habe es geschafft. Ich wollte es nicht, weil mich schon die Kritiken genervt haben (siehe Gewalterfahrungen und 1968 für den Osten), aber ich habe es gelesen. Das neue Buch von Anne Rabe über ihre Gewalterfahrungen mit ihrer Familie nach der Wende: Die Möglichkeit von Glück. Ich hatte erwartet, ein Buch zu lesen, in dem der Kampf einer Familie in der Transformation nach der Wende im Alltag beschrieben wird und die Gewalt, die aus der damit verbunden Anspannung entstehen konnte. Auf dem Cover steht Roman, aber das Buch ist wohl eher ein relativ gradliniger Bericht über ihre Nachforschungen bzgl. ihrer Familienmitglieder und eine sehr eindrückliche Schilderung der Gewalt, die in ihrer Familie üblich war. Das wird gemischt mit Spekulationen darüber, was die Ursachen für Kindstötungen und Amokläufe im Osten gewesen sein könnten. Das Buch hat ein Quellenverzeichnis und ich dachte schon, dass das ein Zeichen für sorgfältiges Arbeiten sein könnte und das Buch doch so etwas wie ein Sachbuch über den Osten sein könnte, aber das Quellenverzeichnis liefert nur die Quellen für die Zitate, die den Kapiteln vorangestellt sind: Thomas Brasch, Bertolt Brecht, Heiner Müller, Robert Havemann und so.
Leser*innen, die diesen Blog nicht kennen, möchte ich noch die Über-Seite nahelegen. Dort steht etwas über meinen Werdegang. Ich hatte nach der Wende die Möglichkeit, glücklich zu werden, und ich hatte Glück. Ich bin keiner der DDR-Nostalgiker, ich bin nicht wie Anne Rabes Eltern, ich war nie in der Partei, aber ich sehe ein großes Problem darin, wie über die DDR geschrieben wird. Nun auch von unseren Kindern, die sie selbst nie erlebt haben.
Nun los.
Psychoeltern und die Unmöglichkeit von Glück
Anne Rabe tut mir Leid. Sie schildert in ihrem Buch eindrücklich die Gewalt, die sie und ihr Bruder durch ihre Eltern und ihre Verwandtschaft (Tanten, Onkels und Großeltern) erfahren hat und welche Folgen das für sie hatte. Man kann ihre Eltern und besonders ihre Mutter wohl als Psychopath*innen bezeichnen. Normal war das jedenfalls nicht. Ihre Mutter hat sie und ihren Bruder in zu heißes Badewasser steigen lassen und erwartet, dass sie sich irgendwie daran gewöhnen. Einmal war es so heiß, dass ihr Vater sie retten musste (Kapitel 33). Im Frühjahr mussten sie zu leicht bekleidet in die Schule gehen (S. 175). Wenn sie beim Essen mit Messer und Gabel Fehler machten, wurden sie geschlagen, auch von Tanten und Onkels. Und Bekannten.
Da fiel mir dann zum Beispiel ein, wie Tim und ich gelernt hatten, ordentlich mit Messer und Gabel zu essen. Wie selbstverständlich es war, dass einem jeder, von den Eltern über die Tanten und Bekannten, ständig auf die Finger schlug.
Rabe, Anne. 2023. Die Möglichkeit von Glück. Stuttgart: Klett-Cotta. S. 116
Auch sonst gab es „ständig“ Kopfnüsse, so dass der Schädel krachte, und andere Schläge (S. 4, 63, 64). Die Mutter hat wochenlang nicht mit ihr gesprochen (Kapitel 41). Der Vater in dieser Zeit nur einmal aus Versehen. Ihre Mutter hat sie gehasst und wollte sie vernichten (S. 218). In Kapitel 17 wird beschrieben, wie ihre Großeltern ihre Tante vom Babyalter bis zum Alter von drei Jahren in einen Schuppen gesperrt haben, wenn sie schrie. Mit drei hat sie dann aufgehört. Die Mutter der Ich-Erzählerin hat es gehört. Später wurde der Bruder der Ich-Erzählerin in den Schuppen gesperrt und die Ich-Erzählerin hört ihn schreien. Ein Missbrauch durch den Vater wird auf S. 83 angedeutet. Auch der Großvater schlug die Großmutter in Anwesenheit der restlichen Familie (S. 245).
Als sie dann von mir ermuntert noch einmal zum Erzählen ansetzte, landete ein Faustschlag an ihrer Schulter, der sie zu mir rüberwanken ließ. „Nun halt aber mal deinen Mund, Ursel.“ So kannte ich es und Oma Ursel auch. Alle, die dabeisaßen, kannten es auch nicht anders. Keiner sagte etwas.
Rabe, Anne. 2023. Die Möglichkeit von Glück. Stuttgart: Klett-Cotta. S. 245
Das alles ist schlimm, ohne Zweifel. Nur stellt sich die Frage, welche Relevanz diese Schilderungen für die Einstufung des Lebens in der DDR haben. Der Roman wurde in der Presse begeistert aufgenommen, er war sogar auf der Shortlist für den Preis des deutschen Buchhandels 2023. Meiner Meinung nach hat das Buch aber überhaupt keine Relevanz für die Einordnung des Lebens in der DDR. Rabe schießt weit über das Ziel hinaus, wenn sie aus ihrem Leben irgendwas für das ganze Land ableiten will. Sie schreibt ja auch selbst, dass ihre Familie anders war als andere:
Alle Familien haben solche Geschichten. Gemeinsame Erlebnisse, die eine Familie zu einer Familie machen. Geschichten, die man sich immer wieder erzählt. Die Geschichten von einem missglückten Weihnachtsbraten, von Irrfahrten zu einem lang ersehnten Urlaubsziel, Missgeschicke und Tollpatschigkeiten, die einem noch immer die Lachtränen in die Augen treiben. Diese Geschichten, an die man denkt, wenn man Zuhause denkt.
Was Tim und ich uns erzählen, wenn wir über unsere Kindheit sprechen, sind Geschichten davon, wie wir gelernt haben, still zu sein.
Rabe, Anne. 2023. Die Möglichkeit von Glück. Stuttgart: Klett-Cotta. S. 23
Auf der Ebene der anekdotischen Evidenz kann ich nur all denjenigen, die die DDR nicht erlebt haben, entweder weil sie im Westen gelebt haben oder noch nicht gebohren waren, versichern, dass Rabes Mutter nicht normal war. In dem Sinne, dass andere Mütter ihre Kinder nicht zu heiß gebadet haben, dass andere Mütter ihre Kinder nicht verbrüht haben. Ich bin in meiner Kindheit wahrscheinlich von meinem Vater geschlagen worden, an konkrete Vorfälle kann ich mich nicht erinnern, aber Ohrfeigen gab es wahrscheinlich. Woran ich mich erinnern kann, ist, dass ich geschüttelt wurde. Das war aber auch selten. Der Zugang zum Werkzeugschrank meines Vaters war bei Androhung „mordsmäßiger Dresche“ verboten. Wahrscheinlich wollte er verhindern, dass ich mir eine Ahle ins Auge stoße oder so was. Die Drohung war krass und der Erfolg durchschlagend: Ich fasse bis heute keine Werkzeugkisten an (Ich glaube, bei so einem ernsten Thema muss man Ironie markieren. Mein Vater hat mit mir gebastelt. Das war schön und ich durfte auch sein Werkzeug benutzen.). Meine Mutter hat mich nie geschlagen. Sie hat es einmal versucht. Da war ich schon 16. Ich hatte sie wirklich zur Weißglut gebracht und sie erhob beide Hände und wollte mich von oben herab schlagen. Ich habe beide ihrer Arme an den Handgelenken gegriffen und sie festgehalten. Wir standen uns gegenüber und ich habe sie angegrinst. Ich hatte ein schlechtes Verhältnis zu meinen Eltern. Eher zu meinem Vater. Er war sehr streng und hielt mich für einen Versager. Das Verhältnis zu meinem Vater ist in folgendem Song von Max Goldt (ausm Westen) ganz gut beschrieben:
Nach der Armee war ich genau einen Tag zuhause und bin dann ausgezogen. Wir haben uns wieder verstanden, nachdem ich mein Studium trotz Beatmusik beendet hatte. (Da ging es mir besser als Tim im Buch, dem Bruder der Ich-Erzählerin.) Unser etwas schwieriges Verhältnis kam wohl daher, dass die frühkindliche Bindung fehlte, denn mein Vater war zu meiner Geburt bei der Armee, arbeitete danach in Berlin und war nur an den Wochenenden da. Erst als ich vier war zogen wir alle nach Berlin. Das Verhältnis zu meinen Geschwistern war viel besser.
Also: Es gab bei mir gelegentliche, sehr seltene, körperliche Strafen, aber nichts von dem was Anne Rabe schildert. Und wenn man sich aus heutiger Sicht über die Züchtigungen zu Recht aufregt, dann muss man bedenken, dass das damals noch üblich war. Im Westen wie im Osten. Ich habe in Gewalterfahrungen und 1968 für den Osten bereits darüber geschrieben: Prügelstrafe in Schulen war im Westen nicht verboten, im Osten sehr wohl. Im privaten Bereich wurde sie erst 2000 verboten, weil eine UN-Vorgabe umgesetzt werden musste. Übrigens durften im Westen bis 1958 nur Väter ihre Kinder verprügeln. Danach waren die Frauen gleichgestellt. Was für ein Fortschritt!
Ich war bei meiner Tante in den Ferien. Zwei Wochen. Sie waren auch öfter bei uns. Ich war regelmäßig bei meinen Großeltern väterlicherseits und bei meinem Großvater mütterlicherseits in den Ferien. Mein Opa war der lustigste, freundlichste und gutmütigste Mensch der Welt. Er hat meine Oma nicht geschlagen und auch sonst niemanden. Niemand, niemand von den Erwachsenen hat mich je geschlagen. Das gilt auch für mein gesamtes anderes Leben. Lehrer und Lehrerinnen, Trainer im Sportverein (Schach, Leichtathletik, Karate), Erwachsene in Arbeitsgemeinschaften (Astronomie, Mathematische Schülergesellschaft), Eltern anderer Kinder und sonstige Bezugspersonen. Nie!
Am 8. Oktober 1989 war ich vor der Gethsemanekirche und wir haben gerufen: Keine Gewalt!
(Vielleicht ist es ja auch das, was dem Westen gefällt: Das Buch von Anne Rabe kann man jetzt dazu benutzen, die Geschichte von diesem einen großen Erfolg der Ossis, dem gewaltlosen Systemumsturz, zu zerstören. Denn in Wirklichkeit waren wir ja alle gewalttätig.)
Eine Sache gehört noch in diesen Abschnitt. Anne Rabe schreibt über das Stillen und das Durchschlafen und den Umgang mit Kindern:
Meine ersten Tage habe ich im Säuglingszimmer zwischen anderen Schreihälsen verbracht. Zu festen Zeiten hat man uns unseren Müttern zum Stillen übergeben und dann gleich wieder in die kleinen Bettchen gelegt. […] Mich hätte man schon nach wenigen Wochen abends einfach bloß ins Bett legen brauchen. Dort sei ich dann eingeschlafen. Ganz von allein. Oder ganz allein. Das Wichtigste für einen ordentlichen Schlafrhythmus sei es, die Stillzeiten einzuhalten, betonte Mutter. Nach vier Wochen hätte ich schon durchgeschlafen.
Rabe, Anne. 2023. Die Möglichkeit von Glück. Stuttgart: Klett-Cotta. S.13–14
Tja, viele in meinem Alter werden das kennen. Viele werden Rechtfertigungen ihrer Eltern kennen. Nur hat das alles nichts mit der DDR zu tun. Die Ursprünge kann man ziemlich genau zurückverfolgen zum Buch Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind von Johanna Haarer von 1934.

Ihr drittes Buch hieß übrigens Mutter, erzähl von Adolf Hitler! und erschien 1939. Ihre Bücher wurden nach dem Krieg durch die Alliierten verboten. Die deutsche Mutter war jedoch nicht totzukriegen und wurde bis 1987 unter dem Titel „Die Mutter und ihr erstes Kind“ weiter veröffentlicht. Wikipedia listet drei Auflagen. Die ersten beiden in Nazi-Deutschland 1934 und 1941. Die zweite dann 338.–440. Tausend Bücher und die letzte Auflage von 1987 dann mit 1222.–1231. Tausend der Gesamtauflage. Wie viel der letzten Auflage verkauft wurde, weiß man nicht, aber es dürften mindestens 1.222.000 Bücher im Umlauf gewesen sein. Ihr könnt ja mal bei Euren deutschen Müttern bzw. Euren deutschen Eltern ins Bücherregal gucken, ob da noch was steht. Theoretisch könnte natürlich auch in der DDR was von den ersten 690.000 Büchern (Kratzer, 2018) übrig geblieben sein, aber da man für Nazi-Literatur bestraft werden konnte, ist es eher unwahrscheinlich. Neu kaufen konnte man es jedenfalls nicht. Wikipedia schreibt dazu: „In der 1949 gegründeten DDR wurde Haarers Buch nicht verlegt.“
Die Zeit-Autorin Anne Kratzer schreibt zum Buch:
„Das Kind wird gefüttert, gebadet und trockengelegt, im Übrigen aber vollkommen in Ruhe gelassen“, riet damals Johanna Haarer. Sie schilderte detailreich körperliche Aspekte, ignorierte aber alles Psychische – und warnte geradezu vor „äffischer“ Zuneigung: „Die Überschüttung des Kindes mit Zärtlichkeiten, etwa gar von Dritten, kann verderblich sein und muss auf die Dauer verweichlichen. Eine gewisse Sparsamkeit in diesen Dingen ist der deutschen Mutter und dem deutschen Kinde sicherlich angemessen.“ […] statt in einer „läppisch-verballhornten Kindersprache“ solle die Mutter ausschließlich in „vernünftigem Deutsch“ mit ihm sprechen, und wenn es schreie, solle man es schreien lassen. Das kräftige die Lungen und härte ab.
Kratzer, Anne. 2018. NS-Geschichte: Warum Hitler bis heute die Erziehung von Kindern beeinflusst. Die Zeit.
Die Kindererziehung im Westen wie im Osten war früher sehr anders. Das hat sich erst im Laufe der Zeit geändert. Hier irgendwie dem Osten einen Strick drehen zu wollen oder Osteltern Vorwürfe machen zu wollen, die man nicht auch Westeltern machen würde, ist ungerechtfertigt.
Und auch noch zu meinem eigenen Erleben als Vater. Ich liebe meine Kinder. Jeden Tag mehr. Ich empfinde eine äffische Zuneigung zu ihnen, ich habe sie nicht in den Schuppen gesperrt, sondern hin und her getragen und gesungen: „Widewidewende heißt meine Puthenne, Sausewind heißt mein Kind, Groterjan heißt mein Hahn, Wiedewiedewende heißt meine Puthenne. Kunterbunt heißt mein Hund. Wiedewiedewende heißt meine Puthenne.“ OK, der Text entsprach nicht genau dem, was man auf youtube sehen kann, aber ich habe auf jeden Fall länger als 2:48 min gesungen. So lange, bis es gut war. (lange, lange) Und ich habe sie ganz fest gehalten. Meine Tochter ist, seit sie ein Jahr alt ist, in der Pubertät. Der ganze Prenzlauer Berg kennt sie. Sie ist eine Legende. Ihr könnt fragen.
Aber manchmal, wenn ich sie auf dem Arm hielt, habe ich mir vorgestellt, sie einfach fallen zu lassen. Ich dachte, dann ist sie wieder weg. Dann ist alles vorbei.
Rabe, Anne. 2023. Die Möglichkeit von Glück. Stuttgart: Klett-Cotta. S.14
Ich weiß warum. Ich kann das verstehen und die völlig fiktionale Person im Roman tut mir Leid. Aber ich würde meine Kinder nie fallen lassen. Ich liebe sie und zwar so sehr, dass ihre Zukunft eine meiner Hauptsorgen ist, weil wir gerade dabei sind, ihre Lebensgrundlagen zu zerstören. Weil mir das alles so wichtig ist, ist die Klimabewegung zu meinem Hauptarbeitsgebiet als Fotograf geworden (Früher war ich Musikfotograf. Ach, war das schön. No future und so.).
Amokläufe
Anne Rabe führt den Amoklauf in Erfurt auf die Ostsozialisation des Amokläufers zurück und beschwert sich darüber, dass das in der Presse damals nicht so gesehen wurde:
Es war der erste sogenannte Amoklauf in Deutschland. Er geschah im Osten des Landes. Aber zum ersten Mal hieß es bei dieser Form der „Jugendgewalt“ nicht, dass es sich um ein Phänomen der Nachwendezeit handeln würde. Die Gewalt an diesem Tag bedeutete siebzehn Tote und eine ganze Schule voller Angst. […] Vielleicht durfte die Tat deshalb nichts mit dem Osten zu tun haben, weil man sie gedanklich über den Atlantik schob. Drei Jahre zuvor hatte es an der Columbine Highschool in den USA ein Massaker gegeben, das Steinhäuser sich zum Vorbild nahm.
Rabe, Anne. 2023. Die Möglichkeit von Glück. Stuttgart: Klett-Cotta. S.193
2002 erschoss der Amokläufer elf Lehrer, eine Referendarin, eine Sekretärin, zwei Schüler und einen Polizisten und sich selbst. 17 Tote. Rabe fragt: „Wie wahrscheinlich war es denn, dass einer in Erfurt aus den gleichen Gründen schießt wie zwei in Colorado[?] Mobbing, Ballerspiele, Leistungsdruck.“ (S. 194)
Worüber die Eltern, Lehrer und Fernsehreportagen nie sprachen, wenn sie für die Schweigeminuten noch einleitende Worte wählten, waren sie selbst. Nie haben sie gefragt, ob die Schüsse in Erfurt auch etwas mit ihnen zu tun haben könnten. Glaubt denn wirklich jemand, dass einer siebzehn Menschen umbringt wegen Abistress? Dass einer siebzehn Menschen abknallt, weil er ein Computerspiel zu oft gespielt hat? Dass einer siebzehn Menschen hinrichtet, weil er Horrorfilme gesehen hat? Ja, ganz sicher, Robert Steinhäuser hat geschossen, weil Mutti und Vati nicht streng genug waren und seine Medienzeit nicht begrenzt haben.
Rabe, Anne. 2023. Die Möglichkeit von Glück. Stuttgart: Klett-Cotta. S.202
Nun gab es aber im Jahre 2009 in Winnenden und Wendlingen einen Amoklauf mit 16 Toten inklusive Amokläufer. Winnenden ist bei Stuttgart, also sehr weit weg von der DDR. Oder zählt das nicht, weil es ein Toter weniger war? Bitte, Frau Rabe, ein bisschen mehr Mühe in der Argumentation hätten Sie sich schon geben können.
Der Psychologe Jens Hoffmann sagt 2016 zu den Amokläufen an Schulen:
Frage: Schulattentäter verfolgen doch keine Ideologie.
Antwort: Doch, interessanterweise gibt es so etwas auch dabei. Erstaunlich viele Schulamokläufer beziehen sich auf das Attentat an der Columbine-Highschool im Jahr 1999. Die beiden Attentäter wollten mit ihren Taten damals eine Revolution der Ausgestoßenen begründen. Das ist vielen auch zwei Jahrzehnte später noch ein Anknüpfungspunkt.
Kramer, Bernd. 2016. „Mehrfachtötungen im öffentlichen Raum“. Interview mit Psychologen Jens Hoffmann. fluter.
2016 gab es einen Amoklauf in München. Von einer 1998 in München geborenen Person. In Wikipedia findet man dazu Folgendes:
Ehemalige Mitschüler sagten, dass er am Tag der Tat durch eine Schulprüfung gefallen sei.
Die Polizei fand in seinem Zimmer das Buch „Amok im Kopf: Warum Schüler töten“ des US-amerikanischen Psychologen Peter Langman, Zeitungsausschnitte über vergangene Amokläufe und Fotos, die er im Vorjahr an Orten des Amoklaufs von Winnenden aufgenommen hatte. Den Anschlag hatte er über etwa ein Jahr hinweg geplant. Im Abschlussbericht der Staatsanwaltschaft München I und des Landeskriminalamts wird zudem darauf hingewiesen, dass Sonboly in „seiner Freizeit […] exzessiv am Computer [spielte], insbesondere sogenannte Ego-Shooter-Spiele.“
Und während ich an diesem Abschnitt arbeite kommt die Meldung von einem bewaffneten Mann in einer Berufsschule in Mölln und deren Evakuierung. Heute.
Das sagt die Forschung zu Erfurt und zu anderen Amoktaten:
Dagegen streben Nachahmungstäter nach der tatsächlichen Umsetzung ihrer Gewaltfantasien (Robertz und Wickenhäuser 2010). Das Columbine-Shooting in Colorado scheint hierbei für viele Jugendliche mit ähnlichen Vorstellungen als „globales Handlungsmodell“ (Levin und Reichelmann 2016, S. 98) zu dienen. Hinweise darauf, dass sich Täter an den Columbine-Taten orientierten, konnten sich in zahlreichen Shoo- tings in den USA, Deutschland, Finnland, Australien, England und Brasilien wiederfinden lassen (Levin und Reichelmann 2016).
So hat man z. B. herausgefunden, dass sowohl der 19-jährige Robert S., der im Jahr 2002 an einem Erfurter Gymnasium 16 Menschen tötete, als auch der 17-jährige Tim K., der im Jahr 2009 an einer Realschule in Winnenden insgesamt 15 Menschen erschoss, vor ihren Taten Internetrecherchen über die Columbine-Täter durchführten. Zudem wurden auf dem Computer von Robert S. gespeicherte Dateien, u. a. zu den Taten an der Columbine High School, gefunden. Hinweise konnten sich außerdem bei Sebastian B. finden lassen, der in Emsdetten im Jahr 2006 mehrere Menschen in seinem Gymnasium verletzte (Verhovnik 2014). In seinem Tagebuch konnten sich Textpassagen mit deutlichem Bezug zu einem der beiden Columbine-Tätern finden lassen: „ERIC HARRIS IST GOTT! Da gibt es keinen Zweifel.“ (Robertz und Wickenhäuser 2010, S. 174). Imitationen der beiden Columbine-Täter konnten außerdem im Tathergang, in der Kleidung (schwarze Handschuhe und Mantel, umgedrehte Baseball-Kappen), der eigenen Überhöhung (Eric S. schrieb den Satz „Ich bin Gott“ in sein Tagebuch), der Handschrift sowie der Bewaffnung gefunden werden (Robertz und Wickenhäuser 2010; Verhovnik 2014).
Zettl, Max Sebastian et. al. 2019. Ursachen. S. 71.
Zu guter Letzt sei noch angemerkt, dass auch die Behauptung, dass der erste Schulamoklauf im Osten stattgefunden habe, einfach falsch ist. Wikipedia ist in solchen Fragen unschlagbar. Es gibt für jeden Tod und Teufel eine Liste. Hier ist die Liste von Amokläufen an Bildungseinrichtungen relevant. Ihr kann man entnehmen, dass der erste Amoklauf bereits 1871 stattfand. Da können Pieck, Ulbricht und die Honeckers nun wirklich nichts dafür. Auch wenn der Amoklauf in Saarbrücken stattfand: Honecker war da noch nicht geboren. Er kam erst 41 Jahre später auf die Welt. Die geneigte Leser*in möge die Liste selbst konsultieren und schauen, wer wann wen gemeuchelt hat. Ich sage nur kurz: 1964, Köln mit Flammenwerfer1, 1983 in Eppstein, Hessen: Schusswaffen2. Auch nach den oben genannten Amokläufe gab es noch viele weitere mit vielen, vielen Toten, die längst wieder in Vergessenheit geraten sind.
Die folgende Tabelle fasst die Daten, Orte und Opfer der Amokläufe nach 1989 zusammen:

Die Verteilung entspricht also genau dem, was man aufgrund der Bevölkerungsgröße erwarten würde: 13 im Westen, nur drei im Osten. Insgesamt sind die Zahlen aber so klein, dass man nichts aus ihnen ableiten kann.
Was Anne Rabe macht, ist Küchenpsychologie. Sie glaubt, den Grund für alle Gewalt im Osten zu kennen. Es ist unverantwortlich vom Verlag gewesen, dieses Buch zu veröffentlichen und es ist kurzsichtig und ebenfalls unverantwortlich von Rezensent*innen, es zu feiern. Das Buch ist eine Vermischung von autofiktionalem Roman und Sachbuch und der Sachbuchteil hätte so nicht veröffentlicht werden dürfen. Oh, sorry, ich habe die Gesamteinschätzung jetzt schon hingeschrieben, aber es gibt noch weitere Punkte.
Kindstötungen
Zwischen der Schilderung einer Gewaltszene unter Jugendlichen und Kommentaren zu den Baseballschlägerjahren findet man folgenden Satz:
Die Zahl der Kindstötungen ist im Osten Deutschlands in den 90er und 00er Jahren doppelt so hoch wie im Westen und steigt im Jahr 2006 sogar auf das Vierfache an.
Rabe, Anne. 2023. Die Möglichkeit von Glück. Stuttgart: Klett-Cotta. S. 204
Will Anne Rabe uns nahelegen, dass alle ihre Kinder umbringen, weil der ganze Osten durch und durch gewalttätig ist? Ginge es nicht irgendwie differenzierter? Vielleicht spielen ja Dinge wie Armut und Perspektivlosigkeit eine Rolle? Insbesondere bei den so genannten Neonatiziden, bei denen ein Kind direkt nach der Geburt getötet wird. Ich habe versucht, mehr darüber herauszufinden, und bin auf die Studie von Höynck, Behnsen & Zähringer (2015) gestoßen. Die Studie führt mehrere Probleme bzgl. der Daten auf:
Ein Punkt, der das Interesse an der Entwicklung des hier vorgestellten Forschungsprojekts ausgelöst hat, war die ausweislich der Polizeilichen Kriminalstatistik nicht unwesentlich höhere Rate von Tötungsdelikten an Kindern in den neuen Bundesländern verglichen mit den alten Bundesländern. Deutlich war aber auch, dass die Frage nach möglichen Ursachen für diesen Befund auf ganz verschiedenen Ebenen liegen können und dass selbst wenn klar wäre, dass es sich nicht z.B. um unterschiedliche Hellfeldraten handelt, sondern um ein tatsächlich höheres Fallaufkommen, ohne Wissen um die jeweiligen Fallgruppenanteile nicht sinnvoll nach möglichen Ursachen gefragt werden kann. Dies bedeutet aber gleichzeitig, dass die Fallzahlen, die für eine Analyse zur Verfügung stehen, nur bei optimalem Rücklauf Rückschlüsse erlauben. Angesichts des unerwartet schwierigen und zudem regional etwas unterschiedlichen Rücklaufes, der dazu führt, dass pro Jahr und Fallgruppe pro Bundesland oft einstellige Fallzahlen zu verzeichnen sind, ist eine regional vergleichende Darstellung der Belastungszahlen mit den einzelnen Fallgruppen irreführend. Die Opferziffern weisen erwartbar große Unterschiede auf, zeigen aber kein klares Schema.
Höynck, Theresia & Behnsen, Mira & Zähringer, Ulrike. 2015. Tötungsdelikte an Kindern unter 6 Jahren in Deutschland: Eine kriminologische Untersuchung anhand von Strafverfahrensakten (1997–2006). S.337
Der einzige Befund, der deutlich wird und aufgrund der verhältnismäßig hohen Fallzahl eine gewisse Belastbarkeit hat, ist, dass vier Bundesländer auffällig hohe Opferziffern bei den Neonatiziden aufweisen. Die durchschnittliche Opferziffer (Opfer pro 100.000 Geburten im selben Jahr) beträgt in dieser Fallgruppe 2,7, die Länderwerte liegen zwischen 0,39 und 11,22. Die vier Länder, die mit Abstand die höchsten Werte aufweisen (7,91 — 11,22), sind Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Der höchste Wert unter den übrigen Ländern liegt bei 3,47. Die kleinste Opferziffer von 0,39 zeigt Schleswig-Holstein. Die Höherbelastung der genannten vier Länder findet keinen zeitlichen Schwerpunkt im Untersuchungszeitraum, sondern streut über die Jahre. Bei allen genannten Werten, dies sei erneut ausdrücklich betont, können Verzerrungen durch den Aktenrücklauf entstanden sein und angesichts insgesamt geringer Zahlen würden sich die Opferziffern schon bei wenigen Fällen Unterschied nennenswert ändern. Geht man davon aus, dass der Rücklauf nicht systematisch verzerrt ist, stellen die genannten Zahlen jedenfalls Unterschätzungen dar. Aufgrund der Ausfalls von 41 % gegenüber den Zahlen der PKS kann auch nicht mit Sicherheit geschlossen werden, dass die Höherbelastung der neuen Länder mit Tötungsdelikten an Kindern unter 6 Jahren, die eben aufgrund den Daten der PKS (mit) einen Anlass für die vorliegende Untersuchung darstellte, auf einer Höherbelastung mit Neonatiziden beruht. Die Daten sprechen allerdings durchaus für diese Annahme. Über die Gründe hierfür kann nur spekuliert werden.
Erstens könnte es verschiedene Hellfeldraten geben. Das heißt, im Osten könnten ein größerer oder kleinerer Anteil der Kindstötungen gemeldet worden sein als im Westen. Zweitens sind – wie die Autorinnen der Studie betonen – die Statistiken anhand der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) berechnet worden. Diese spiegeln die Ermittlungsergebnisse, d.h. Vermutungen über Tathergänge und Schuld wieder. Wichtig sind aber die Prozessakten, denn es kann sich in einem Gerichtsverfahren die Unschuld einer beschuldigten Person herausstellen. Da der Rücklauf nur bei nur 59% der Akten lag, ist die Zahl der untersuchbaren Fälle noch niedriger als ohnehin schon.
Und dann, liebe Anne Rabe, sie stoßen ein ganzes Land in die Scheiße bzw. kippen Scheiße über ihm aus. Wenn Sie das tun, sollten Sie ruhig, rational und sehr genau vorgehen. Was Sie schreiben ist – so wie sie es geschrieben haben – garantiert falsch. Denn Sie schreiben über die absoluten Zahlen der Kindstötungen. Untersucht wurde die Anzahl der Kindstötungen unter 100.000 Kindern im Alter unter 6 Jahren. Die absoluten Zahlen für 2006 sind für Westdeutschland 48 und für Ostdeutschland 34. Die Zahlen für die anderen Jahre kann man ebenfalls der Tabelle entnehmen:

Wie die Autorinnen anmerken, sind das (rein mathematisch gesehen) sehr kleine Zahlen, was eine sinnvolle Auswertung erschwert:
Zu beachten ist zudem, dass Delikte erst nach Abschluss der Ermittlungen, und damit frühestens im Jahr ihres Bekanntwerdens in die PKS aufgenommen werden, was nicht in jedem Fall identisch mit dem Jahr der Tatbegehung ist. In einem extremen Fall wie dem der neun tot aufgefundenen Neugeborenen in Brieskow-Finkenherd führt dies aufgrund insgesamt kleiner Fallzahlen bereits bei einer nur groben regionalen Untergliederung zu einer spürbaren Verzerrung der Statistik für das Erfassungsjahr 2006 (vgl. die Werte für Ostdeutschland in Abbildung 1).
Höynck, Theresia & Behnsen, Mira & Zähringer, Ulrike. 2015. Tötungsdelikte an Kindern unter 6 Jahren in Deutschland: Eine kriminologische Untersuchung anhand von Strafverfahrensakten (1997–2006). S. 16
Rabe erwähnt den Fall in Brieskow-Finkenheerd (spricht allerdings von Frankfurt/Oder). Dass die Fälle von Kindstötung, die zwischen 1988 und 1999 stattgefunden haben, wie sie selbst schreibt (S. 203) in die Statistik des Jahres 2006 eingehen, ist ihr nicht klar.
Vielleicht kann man nicht von jeder Autorin verlangen, dass sie sich wirklich mit Statistik beschäftigt, aber von einer Autorin, die ein politisch brisantes Buch schreibt, sollte man das verlangen. Und erst recht von einem Verlag, der das Buch dann herausbringt. Und von Rezensenten, die das Buch besprechen. Ich habe mich einen Tag mit dem Thema Kindstötung beschäftigt und ohne Fachwissenschaftler zu sein, die hier diskutierte Information gefunden. Warum hat das niemand von den genannten Personen getan? Weil das Bild, das die Autorin zeichnet, gar zu schön ist? Weil es passt?
Die Fallzahlen bei den extremeren Fällen sind niedrig. Man kann und muss jeden Einzelfall ansehen. Zur Einordnung in ein Gesamtbild braucht man eine Qualifikation. Jemand der wie Anne Rabe Germanistik, Theaterwissenschaft und Szenisches Schreiben oder wie ich Informatik studiert hat, hat diese Qualifikation nicht. Auch die Lektorin Corinna Kroker (Buchwissenschaft / Verlagspraxis, Literaturwissenschaft, Spanisch und Psychologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München) und die Jury des Deutschen Buchpreises 2023 haben diese Qualifikation nicht. Aber alle sind hochgebildete Menschen, denen zumindest klar sein sollte, dass sie nicht über die relevante Qualifikation verfügen.
Die FAZ berichtet schon 2006 über Untersuchungen von Ulrike Böhm (Uni Leipzig). Die Forscher*innen haben 1000 Todesfälle überprüft und kommen zu folgendem Schluss:
Dafür, daß Kinder im Osten Deutschlands häufiger an Mißhandlung oder Vernachlässigung sterben als im Westen, haben die Leipziger Forscher keine Belege gefunden. Auch sieht Böhm die Aussage des Kriminologen Christian Pfeiffer, das Risiko für Kinder in Ostdeutschland, von ihren Eltern mißhandelt zu werden, sei gut doppelt so hoch wie für Kinder in Westdeutschland, durch ihre Ergebnisse nicht bestätigt. „Der Unterschied liegt eher zwischen Großstadt und ländlichem Raum.“
Burger, Reiner. 2006. Studie zu Kindesmißbrauch: Immer mehr Eltern sind erziehungsunfähig. Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Diese Aussage ist interessant, denn sie deckt sich mit Befunden zu rechtsextremen Einstellungen. Auch da ist es so, dass es einen Stadt-Land-Unterschied gibt. Der Osten hat über weite Teile des Landes eine ländlichere Struktur und vergleichbare Gegenden im Westen sind ähnlich in Bezug auf politische Ansichten („Die These vom Rechtsruck im Osten ist Unsinn.“. Berliner Zeitung. 08.07.2023)
Kinderpornographie, Pädophilie und Vergewaltigung in der Ehe
Wollen wir wirklich einen Krieg anfangen, in dem wir gucken, wer scheißer ist? Mir fallen diverse Kinderpornohandelsringe ein, Skandale auf Zeltplätzen (Missbrauchsfälle in Lügde: „Das ist abgründig“), Missbrauch durch Kirchenmenschen. Katholische und evangelische. Misshandlungen in Kinderheimen, oft mit kirchlichen Trägern (siehe Blog-Post Kinderverschickung und die DDR?). Brutale Fälle von Kindesmissbrauch in Saarbrücken. Mütter, die anderen ihre Kleinkinder und Babies für Sex anbieten. Es gibt schlimme Dinge, hier wie da. Soll man daraus was ableiten? Etwas über den Osten? Etwas über den Kapitalismus?
Und wie war das mit der Vergewaltigung in der Ehe?

Wer war 1997 nach 25jähriger Diskussion im Bundestag gegen die Gesetzesänderung, die diese Vergewaltigungen erst anderen Vergewaltigungen gleichsetze? 183 Nein-Stimmen, darunter Horst Seehofer, Volker Kauder und Friedrich Merz. Die Namen sind fein säuberlich in den Bundestagsprotokollen notiert. Originaltöne der Männer zum Thema kann man im Panorama-Beitrag sehen.
Warum kein Sachbuch?
Cornelia Geißler von der Berliner Zeitung fragt in einem Interview: „Wie kam es nun zum Roman? Warum haben Sie kein Sachbuch geschrieben?“. Die Antwort ist interessant:
Weil die Fiktionalisierung mir mehr Freiheit lässt. In einigen Bereichen gibt es einfach zu wenige Zahlen, um sie als Fakten beschreiben zu können. Das betrifft zum Beispiel Kindesmisshandlung, da wurde die Forschung in der DDR eingestellt, auch sexualisierte Gewalt war in der DDR tabuisiert, auch dazu gab es keine Studien, nur eine lose Sammlung von Fragebögen von Bürgerrechtlerinnen. Im Roman kann ich Dinge nebeneinanderstellen und nebeneinander wirken lassen, ohne sagen zu müssen, dieses folge zwangsläufig aus jenem.
Geißler, Cornelia. 2023. Anne Rabe: „Es reicht nicht, die DDR immer nur vom Ende her zu erzählen“. Berliner Zeitung. 25.04.2023. Berlin.
Das ist eine ehrliche Antwort. Aus der DDR-Zeit gibt es sicher zu wenig Zahlen. Aber Anne Rabe verbreitet Unwahrheiten über die Nachwendezeit, wie ich oben detailliert dargelegt habe. Die Information, die sie gebraucht hätte, liegt praktisch auf der Straße. Ich habe alles innerhalb eines Tages herausfinden können. Es gibt ausführliche Wikipedia-Artikel zu den Themen und in denen findet man die Verweise auf die Fachliteratur. Schön, dass Anne Rabe selbst sagt, dass sie einfach Dinge nebeneinander stellt, ohne eine kausale Wirkung zu behaupten. Das ist der Unterschied zwischen Semantik und Pragmatik. Die Leser*innen und Rezensent*innen zeihen die Schlüsse selber. Ich war’s nicht, ich war’s nicht. Ich habe nur Fakten nebeneinandergestellt, die Vermutungen darüber, was ich damit gemeint haben könnte, habt ihr selbst gezogen. Und dazu waren die Fakten noch nicht mal Fakten.
Gewalterfahrung von Kindern im Osten und Westen
(Abschnitt am 20.05.2024 eingefügt)
Anne Rabe berichtet von einzelnen Vorkommnissen, von denen man nicht weiß, ob sie wirklich so stattgefunden haben. Manches ist einfach unplausibel. Auf der Ebene der anekdotischen Evidenz ist es aber ohnehin nicht möglich, zu einem tragfähigen Ost-West-Vergleich zu kommen. Dazu braucht es empirische Studien. In Gesprächen (z.B. im taz-Lab 27.04.2024 mit Simone Schmollack und im oben zitierten Interview mit Cornelia Geissler) weist Anne Rabe darauf hin, dass es keine Studien aus DDR-Zeiten gibt. Allerdings hat Sabine Rennefanz am 30.09.2023 im Tagesspiegel auf eine Studie mit 5800 vor 1980 geborenen Teilnehmer*innen aus West und Ost zu deren Gewalterfahrungen in der Kindheit berichtet (Ulke C. et al. 2021). Die Studie wurde im Jahre 2021 an der Uni Leipzig durchgeführt und von den Medien weitestgehend ignoriert. Das Ergebnis war, dass es im Westen mehr körperliche und sexuelle Gewalt gab (Zum Beispiel besonders deutlich: 13,2 % der westdeutschen Frauen haben in ihrer Kindheit sexuelle Gewalt erfahren. Im Osten waren es 7,8 %). Anne Rabes Theorie vom diktaturgeprägten gewalttätigen Osten entbehrt also jeder empirischen Grundlage. Die Fakten waren vor der ersten Auflage 2023 und während der Zeit, in der die Jury des deutschen Buchpreises die Bücher für die Shortlist auswählte.
Zusammenfassung
Ich denke, dass Anne Rabe eine schreckliche Kindheit in einer schrecklichen Familie (inklusive Tanten, Onkels und Großeltern) hatte. Sie hat sich daraus befreit, aber die Konsequenzen und Schlussfolgerungen, die sie zieht, sind nicht tragfähig. Ihre Erfahrungen sind nicht verallgemeinerbar. Behauptungen im Buch sind nicht belegt und wenn man nachforscht, stellt sich heraus, dass sie nicht belegbar oder an den Haaren herbeigezogen (bitte entschuldigt das gewalttätige Bild) sind.
Danksagungen
Ich danke Immanuel Zirkler, der den Panorama-Beitrag zur Vergewaltigung in der Ehe, gefunden hat, und allen Diskussionsteilnehmer*innen auf Mastodon.
Quellen
Beer, Maximilian & Hollersen, Wiebke. 2023. „Die These vom Rechtsruck im Osten ist Unsinn.“. Berliner Zeitung. 08.07.2023. (https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/die-these-vom-rechtsruck-ist-unsinn-forscher-ueber-ostdeutschland-extremismus-und-afd-li.366563)
Bundestag. 1997. Stenographischer Bericht, 175. Sitzung. 15.05.1997. Bonn: Deutscher Bundestag. (https://dserver.bundestag.de/btp/13/13175.pdf)
Burger, Reiner. 2006. Studie zu Kindesmißbrauch: Immer mehr Eltern sind erziehungsunfähig. Frankfurter Allgemeine Zeitung. (https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/kriminalitaet/studie-zu-kindesmissbrauch-immer-mehr-eltern-sind-erziehungsunfaehig-1385344.html)
Geipel, Ines. 2019. „Für heute reicht’s“: Amok in Erfurt (Rowohlt Repertoire). Hamburg: Rowohlt Verlag.
Geißler, Cornelia. 2023. Anne Rabe: „Es reicht nicht, die DDR immer nur vom Ende her zu erzählen“. Berliner Zeitung. 25.04.2023. Berlin. (https://www.berliner-zeitung.de/kultur-vergnuegen/literatur/osten-interview-schriftstellerin-anne-rabe-es-reicht-nicht-die-ddr-immer-nur-vom-ende-her-zu-erzaehlen-debatte-dirk-oschmann-li.341318)
Höynck, Theresia & Behnsen, Mira & Zähringer, Ulrike. 2015. Tötungsdelikte an Kindern unter 6 Jahren in Deutschland: Eine kriminologische Untersuchung anhand von Strafverfahrensakten (1997–2006). Wiesbaden: Springer. (https://doi.org/10.1007/978–3‑658–07587‑3)
Kramer, Bernd. 2016. „Mehrfachtötungen im öffentlichen Raum“. fluter. (https://www.fluter.de/terroranschlag-oder-amoklauf-unterschiede-und-gemeinsamkeiten)
Kratzer, Anne. 2018. NS-Geschichte: Warum Hitler bis heute die Erziehung von Kindern beeinflusst. Die Zeit. (https://www.zeit.de/wissen/geschichte/2018–07/ns-geschichte-mutter-kind-beziehung-kindererziehung-nazizeit-adolf-hitler)
Mika, Bascha. 1996. „Ich hab’ sie verpackt wie einen Bonbon“. taz. Berlin. 18.09.1996 (https://taz.de/!1437345/)
Panorama. 1995. Vergewaltigung mit Trauschein. ARD. (Panorama. 23.03.1995) (https://www.ardmediathek.de/video/panorama/vergewaltigung-mit-trauschein/das-erste/Y3JpZDovL25kci5kZS9kZDFmYjg0NC00NDk0LTQ0MmYtODU2MS1mMGFjZDVlMWYwNzI)
Rath, Christian. 2023. Tötung eines Mädchens in Freudenberg: Verdächtigte Mädchen ohne Strafe. taz. Berlin. 15.03.2023 (https://taz.de/Toetung-eines-Maedchens-in-Freudenberg/!5918971/)
Rennefanz, Sabine. 2023. Die westdeutsche Brille: Eine weithin ignorierte Studie über Gewalt in Ost und West gibt neu zu denken. Tagesspiegel. Berlin. 30.09.2023 (https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/die-westdeutsche-brille-eine-weithin-ignorierte-studie-uber-gewalt-in-ost-und-west-lasst-neu-denken-10543546.html)
Schmollack, Simone. 2019. Missbrauchsfälle in Lügde: „Das ist abgründig“. taz. Berlin. (https://taz.de/Missbrauchsfaelle-in-Luegde/!5614996/)
Ulke, C. & Fleischer, T. & Muehlan, H. & Altweck, L. & Hahm, S. & Glaesmer, H. & Fegert, J.M. et al. 2021. Socio-political context as determinant of childhood maltreatment: A population-based study among women and men in East and West Germany. Epidemiology and Psychiatric Sciences (30). 1–8. (doi:10.1017/S2045796021000585)
Zettl, Max Sebastian & Bock, Corinne & Buderus, Petra & Pereira, Anne-Sophie & Gonçalves, Katya & Münch, Eva Elisabeth. 2019. Ursachen. In Böhmer, Matthias (ed.), Amok an Schulen: Prävention, Intervention und Nachsorge bei School Shootings. Wiesbaden: Springer. (https://doi.org/10.1007/978–3‑658–22708‑1)